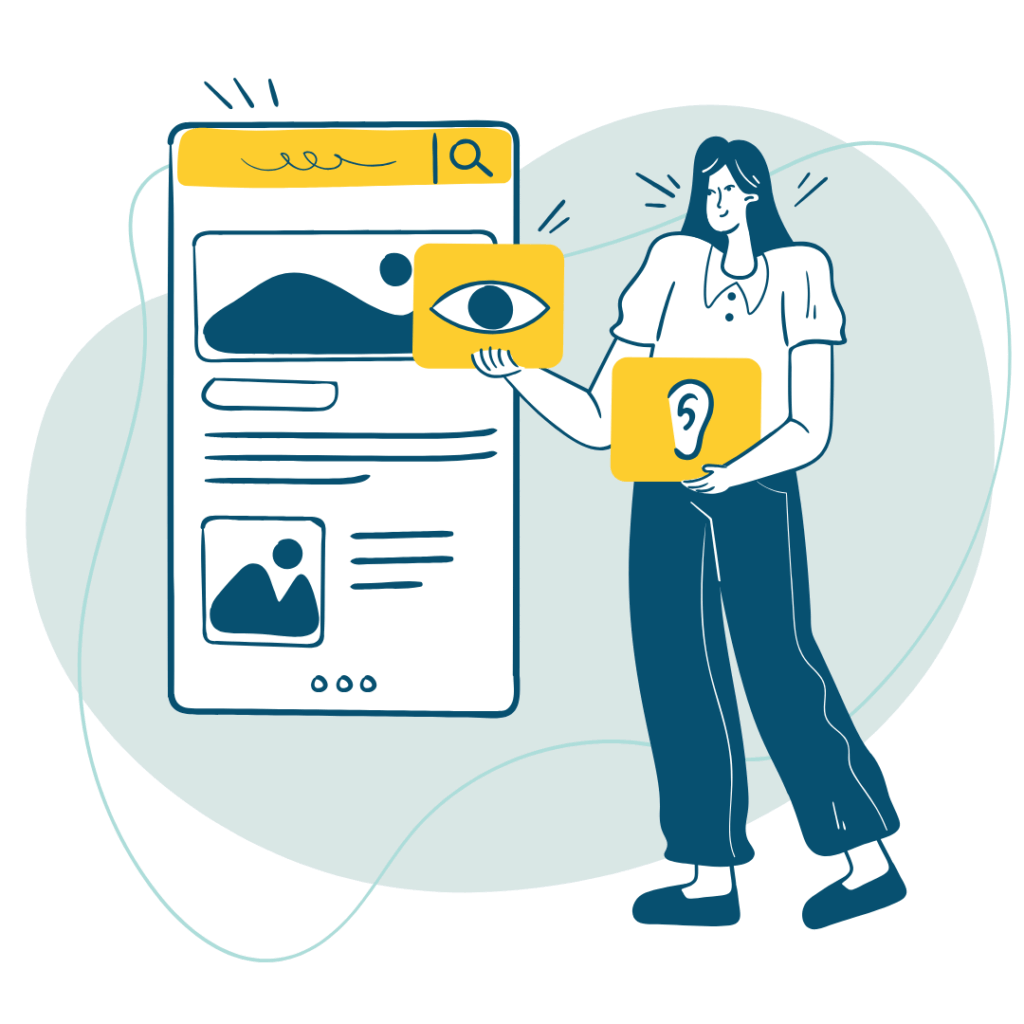
Hand aufs Herz: Was fällt Ihnen spontan zu „Barrierefreiheit“ ein? Eine Rampe? Ein Aufzug?
Selbstverständlich sind das zentrale Elemente. Aber wenn wir über barrierefreies Design im Gesundheitswesensprechen, gilt es, neben physischen Hindernissen auch Barrieren in der visuellen und sprachlichen Kommunikation abzubauen. Die schönste Praxis-Website nützt zum Beispiel wenig, wenn sie für manche Menschen nicht lesbar ist.
Barrierefreies Design im Gesundheitswesen macht Ihre Angebote zugänglich – und genau das spielt in einem Umfeld, in dem es um Vertrauen und Sicherheit geht, eine essenzielle Rolle.
Was ist barrierefreies Design – und warum sage ich lieber „barrierearm“?
Barrierefreies Design meint allgemein die Gestaltung von digitalen und analogen Medien, die möglichst viele Menschen nutzen können – unabhängig von körperlichen, kognitiven oder sprachlichen Voraussetzungen. Gerade im Healthcare-Marketing begegnen wir jedoch einer enormen Vielfalt an Bedürfnissen, Lebenssituationen und Kommunikationsstilen. Deshalb spreche ich im Rahmen meiner Arbeit bewusst von barrierearmem Design: Ein Begriff, der anerkennt, dass es keine Lösung gibt, die für alle perfekt ist.
„Ich nutze bevorzugt den Begriff barrierearmes Design. Denn die perfekte Lösung für alle gibt es selten. Aber: Wir können vieles besser machen – und genau das ist es, was zählt.“
Isabel von Bentheim, Expertin für Marketing und barrierearmes Design im Gesundheitswesen
Vorteile von barrierefreiem Design im Gesundheitswesen
- Inklusion fördern: Ihre Kommunikation erreicht Menschen unabhängig von Einschränkungen, Sprachbarrieren oder Stresslevel. Damit zeigen Sie Haltung und soziale Verantwortung.
- Vertrauen aufbauen: Ihre Patient:innen und Klient:innen spüren „Ich bin mitgedacht.“ Das stärkt die Bindung und das Gefühl von Sicherheit in sensiblen Gesundheitsfragen.
- Zugänglichkeit verbessern: Klare Sprache, gute Lesbarkeit und intuitive Gestaltung helfen allen – besonders älteren Personen, Menschen mit wenig Zeit oder in belastenden Situationen.
- Reichweite erhöhen: Barrierearme Inhalte sind in der Regel suchmaschinenfreundlicher (Stichwort: Voice Search, einfache Sprache, strukturierte Inhalte) und werden gerne geteilt.
- Effizienz steigern: Weniger Rückfragen, weniger Missverständnisse – eine klare visuelle und sprachliche Kommunikation spart Zeit und Ressourcen im Praxisalltag.
Gut zu wissen: Auch aus rechtlicher Sicht ist barrierefreies Design im Gesundheitswesen wichtig.
Seit dem 28. Juni 2025 gilt das sogenannte Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG). Es verpflichtet bestimmte Anbieter wie Arztpraxen, Apotheken oder Krankenhäuser dazu, ihre digitalen Angebote barrierefrei zu gestalten. Die Regelung richtet sich vor allem an Einrichtungen, die digitale Dienstleistungen für Verbraucher:innen bereitstellen und dabei als sogenannte „Wirtschaftsteilnehmer“ gelten.
Beispiele für barrierefreies Design im Gesundheitswesen
Barrierefreies bzw. barrierearmes Design betrifft nicht nur digitale Kanäle wie Websites oder Social Media – auch analoge Medien wie Flyer, Terminkärtchen oder Patienteninformationen sollten Sie berücksichtigen.
Die folgende Tabelle zeigt einige Beispiele für barrierefreie Kommunikation und Marketing im Gesundheitswesen.
Digitale Barrierefreiheit
Website Buttons, die groß genug sind und sich auch mit dem Finger auf dem Smartphone gut treffen lassen
Bilder mit Alternativtexten, damit auch Menschen mit Sehbehinderung wissen, was gezeigt wird
Videos mit Untertiteln, für Menschen mit Hörbeeinträchtigung
Analoge Barrierefreiheit
Terminkärtchen, auf denen die Uhrzeit groß und kontrastreich steht und die auch ohne Brille gut lesbar sind
Anamnesebögen, in Alltagssprache – statt „anamnestische Vorerkrankungen“ zum Beispiel einfach „Welche Krankheiten hatten Sie früher?“
Infoblätter, mit klarer Struktur durch Zwischenüberschriften und Bulletpoints
Mehrsprachige Materialien, wenn Ihre Zielgruppe nicht nur Deutsch spricht
Checkliste: So setzen Sie barrierefreies Design im Gesundheitswesen um
Sie möchten Ihre Kommunikation und Gestaltung inklusiver gestalten – wissen aber nicht genau, wo Sie anfangen sollen? Ob Gesundheitspraxis, Psychotherapie oder Digital Health Startup: Meine Checkliste für barrierefreies Design im Gesundheitswesen hilft Ihnen dabei, erste konkrete Schritte zu gehen. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Umsetzen!
Checkliste für digitale Kommunikation
- Klare Sprache: Verwenden Sie kurze, einfache Sätze und vermeiden Sie Fachbegriffe – zum Beispiel „Blutdruck“ statt „Hypertonie“. Dadurch verstehen auch Menschen ohne medizinisches Vorwissen Ihre Inhalte.
- Kontraste prüfen: Achten Sie darauf, dass sich Text deutlich vom Hintergrund abhebt. Hellgrau auf Weiß ist zwar modern, aber schwer lesbar – gerade für Menschen mit Sehschwäche.
- Farbwelt bewusst wählen: Farben wie Blau oder Grün beruhigen und wirken vertrauensfördernd, während warme Töne wie Apricot oder Sand Nähe und Wärme vermitteln. Wählen Sie Farben nach gewünschter Wirkung, nicht nur nach Ihrem Geschmack.
- Alternativtexte für Bilder und Grafiken: Wenn Sie Ihre Healthcare-Website erstellen, beschreiben Sie kurz, was auf Bildern zu sehen ist, zum Beispiel „Foto einer Ärztin, die einem Patienten Blutdruck misst“. So können auch Nutzer:innen mit Screenreader Ihre Inhalte erfassen
- Untertitel für Videos: Untertitel helfen nicht nur Menschen mit Hörbeeinträchtigung, sondern auch denjenigen, die Videos ohne Ton schauen – etwa unterwegs oder in Wartezimmern.
- Layouts angenehm gestalten: Überladen Sie Ihre Website nicht. Elemente sollten ausreichend Abstand zueinander haben – denn Weißraum schafft Ruhe und Orientierung.
- Bildsprache mit Nähe und Empathie: Verwenden Sie lieber authentische Bilder aus dem Praxisalltag, Porträts oder Szenen mit echter Interaktion. Das schafft mehr Vertrauen als austauschbare Stockfotos.
- Navigation intuitiv und logisch: Strukturieren Sie Ihr Website-Menü mit verständlichen Begriffen und wenigen Klicks zum Ziel.
- Keine Informationen ausschließlich über Farbe oder Symbole: Wenn Sie beispielsweise Termine mit Farben kennzeichnen („rot = ausgebucht“), ergänzen Sie diese Information auch textlich.
- Inhalte auch bei eingeschränkter Internetverbindung nutzbar: Vermeiden Sie große Dateien oder komplexe Animationen, die lange Ladezeiten verursachen. So bleiben Ihre Inhalte in ländlichen Regionen oder auf älteren Geräten zugänglich.
Checkliste für Printmaterialien
- Große, gut lesbare Schrift: Wählen Sie eine Schriftgröße von mindestens 12 pt oder 14 pt. Verzichten Sie auf verschnörkelte oder zu dünne Schriftarten.
- Hoher Kontrast zwischen Text und Hintergrund: Dunkle Schrift auf hellem Hintergrund funktioniert am besten. Achten Sie darauf, dass Farben nicht verschwimmen – beispielsweise kein Hellblau auf Weiß.
- Klare Gliederung: Nutzen Sie Zwischenüberschriften, Absätze und Bulletpoints. So können Leser:innen Inhalte selbst mit wenig Konzentration oder Zeit schnell erfassen.
- Einfache Sprache: Schreiben Sie so, wie Sie sprechen würden und vermeiden Sie Fachjargon.
- Verzicht auf Blocksatz: Linksbündiger Text ist leichter lesbar, weil die Wortabstände gleich bleiben. Blocksatz kann zu unregelmäßigen Lücken führen.
- Papierqualität bedenken: Mattes Papier reflektiert weniger Licht und ist angenehmer zu lesen – zum Beispiel für ältere Menschen oder bei künstlicher Beleuchtung.
- Piktogramme mit erklärendem Text: Symbole sind hilfreich, sofern sie eindeutig sind. Ergänzen Sie sie mit kurzen Texten, beispielsweise „Rollstuhlgerecht“ statt nur ein Rollstuhl-Symbol.
- QR-Codes mit Hinweis: Wenn Sie QR-Codes verwenden, schreiben Sie dazu, was sich dahinter verbirgt. Beispiele: „Scannen für Terminbuchung“ oder „Mehr Infos zur Behandlung“.
- Mehrsprachige Versionen: Wenn Ihre Zielgruppe es braucht, bieten Sie Materialien in anderen Sprachen an. Das zeigt Wertschätzung und erleichtert den Zugang.
Sie sehen: Barrierefreies Design im Gesundheitswesen ist grundsätzlich kein Hexenwerk.
Wenn Sie möchten, dass Ihre Kommunikation nicht nur funktioniert, sondern auch berührt und Vertrauen schafft, stehe ich Ihnen als Expertin für Healthcare-Marketing und barrierearmes Design gerne zur Seite.

